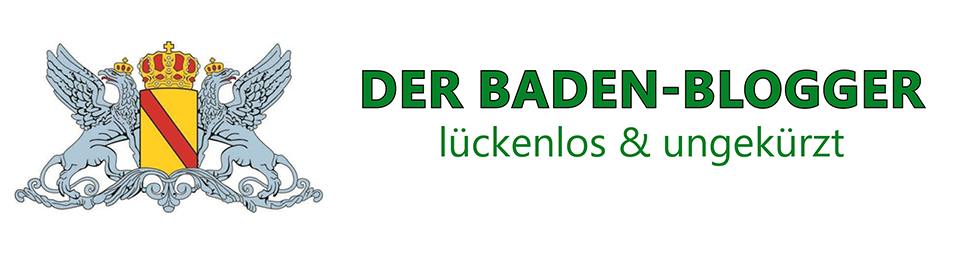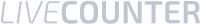Dieses lang und sorgsam gepflegte Etikett scheint momentan etwas Farbe zu verlieren. In der Sophienstraße, einer der edleren Verkaufslagen, tauchen die ersten Leerstände auf. Nun hat auch noch die Renommiermarke HERMES beschlossen, ihr Geschäft zu schließen. Schlimmer wird’s nimmer?
Doch gemach. Noch sind sie vereinzelt zu sehen, die Leuchttürme des gehoben Geschmacks. Nach wie vor ist hier der Luxus zu hause, so hat z.B. Juwelier NITTEL erst jüngst eine Dependance eröffnet. Und auch das edle „Kaffee König“ schräg gegenüber lebt vom gepflegten Auftritt des Personal und der althergebrachten Qualität der Ware. Ein Hauch von gestern auch noch draußen in Iffezheim, wo beim Pferderennen zweimal jährlich der aufwändige Hutschmuck der Damen der Welt zeigen soll, wo oben ist.
Inmitten der illustren Gesellschaft immer präsent auch eine Blumenverkäuferin. Sie heißt Monika Bajusz-Münz, gebürtige Ungarnin und war 2023 nach Baden-Baden gekommen, in ein ‚Schmuckkästchen´, sozusagen. Für sie war es Liebe auf den ersten Blick, wo sie alsbald versuchen sollte, aus ihrer großen Liebe ein Geschäft zu zu machen; sie will das Glück in Form von Rosen zu den Menschen bringen.
Immer schon war sie nach eigener Aussage vom Glamour fasziniert. Im Gespräch fallen hier Vorbilder wie Marilyn Monroe und Audrey Hepburn. Aber auch die schiere Zahl ihrer extravaganten Hüte (deren Zahl sie mit fünfzehn angibt) sorgt dafür, dass sie mit ihrem ausgefallenen Äußeren draußen auf der Rennbahn, aber auch in der Innenstadt für Eleganz steht, für Lebensart. Wie eine Botin aus leider vergangener Zeit. Hier ist man versucht, so etwas Niveau zu nennen, wenn sie dem Publikum mit ihren ihren anmutig drapierten langstieligen Rosen zeigt, dass so ein Auftritt in seiner etwas gehobenen Form durchaus noch zeitgemäß sein kann.
Dass freilich auch sie nicht immer auf Rosen gebettet ist, durfte die Baden-Badener Öffentlichkeit dem ‚Badischen Tagblatt‘ entnehmen, wo zu lesen war, dass sie mit all ihrem Ersparten einem Betrüger aufgesessen und sich am Ende um ihr Gespartes gebracht sah. Nach langem juristischen Scharmützel sollte es am Ende letztlich noch einigermaßen gut ausgehen, doch wurde die Malaise in der ortsansässigen Presse weidlich zur Kenntnis genommen, ein Ärgernis, das das Darreichen von langstieligen Edelgewächsen allerdings nicht beeinträchtigen sollte.
 Im nachhinein eine mehr als eine nur lästige Petitesse, die sie im geblümelten Alltag aber tapfer weglächelt. Es müsste nicht Baden-Baden sein, wo man für Verlust und Gewinn mehr als nur Verständnis zeigt, wo Gewinner und Verlierer Teil des ortsansässigen Personaltableaus sind. Was soll man machen?
Im nachhinein eine mehr als eine nur lästige Petitesse, die sie im geblümelten Alltag aber tapfer weglächelt. Es müsste nicht Baden-Baden sein, wo man für Verlust und Gewinn mehr als nur Verständnis zeigt, wo Gewinner und Verlierer Teil des ortsansässigen Personaltableaus sind. Was soll man machen?
Das Geschäft muss weiter gehen. Und so schwebt auch weiterhin das opulentes Gebilde namens Hut über den Niederungen eines etwaigen Verlustes von Barmitteln. Der Beruf einer Rosenverkäuferin hat anderen Schmerz im Portfolio. So etwa wenn 70% aller Männer ihre Begleiterinnen fagen, ob sie eine Rose wünscht? „Wie blöd seid ihr!“, sagt Monika Bajusz-Münz mit ungewohnter Heftigkeit. Was soll so eine Frau denn sagen? „Sie steht doch mit dem Rücken zur Wand?“
Monika Bajusz-Münz, deren Erscheinung ansich schon für reine Weiblichkeit steht, plädiert auf Nachdrücklichste dafür, dass Frauen Frauen und Männer Gentlemen sind. Dass den Frauen wieder in Mänteln geholfen und die Türen wieder von Männern geöffnet werden. Was für ein Unglück, klagen Frauen ihr gegenüber: „Weißt Du Monika, ich habe noch nie eine Rose bekommen!“
Um das zu ändern ist sie tagein tagaus mit der Mission ‚Rosen´ unterwegs, ganzjährig und wetterunabhängig. Kein Tag ist wie der andere, kein Kunde wie der andere. Der Mensch ist unberechenbar. „Denke nicht für andere“, sagt sie sich dann. Kennt man ihn denn wirklich, der, der seiner Frau Blumen eventuell kaufen könnte? Sie schütteln den Kopf. Der Mann ist und bleibt ein rätselhaftes Wesen.
Mit derlei Gedanken aber will sie sich gar nicht lange aufhalten. Neues Spiel, neues Glück. Wer meint, sie mit ihrem langstieligen Angebot nicht zu brauchen – selber Schuld. Eine lästige Petitesse, die sie weglacht. Was soll man auch machen? Täglich schlüpft sie in die Rolle ihres Lebens. Nie würde sie ungeschminkt aus dem Haus gehen. Nackt würde sie sich fühlen, so ganz ohne Schminke. Ist sie dann aber in ihre Rolle, ist sie ganz bei sich. Baden-Baden, mon amour. Die Sonne lacht. Hinter ihr das Vergangene, vor ihr die Lichtentaler Allee.
Nur so schafft sie es, den potentiellen Kundinnen zu vermitteln, wie schön es doch sein könnte, das Leben an der Seite einer roten Rose. Kommt es dann endlich dazu – bitte sehr! Dann gibt’s eine Rose, ganz ohne Dornen, frisch geschnitten und von einem Duft, den sie betörend nennt.
So eine Rose wird schließlich ja nicht verkauft. Sie wird gereicht.