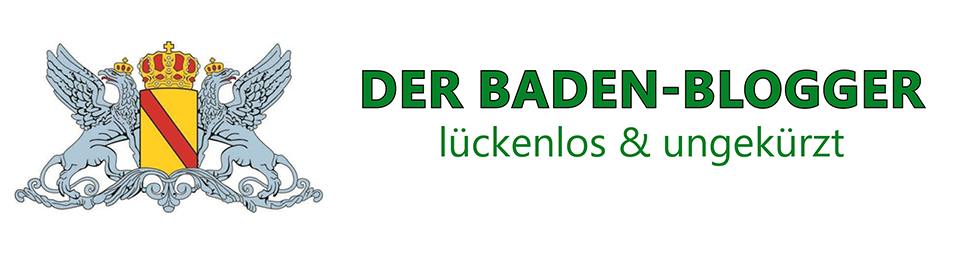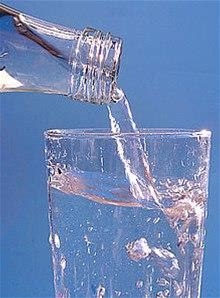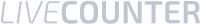Wie Paracelsus einmal unseren Markgrafen beschimpfte
Der Frühling kommt. Der Maler geht. Ein rundum gelungener Abschluss? Als der kleine weißlackierte Transporter der Firma Dieterle aus Forbach vom Parkplatz vor der Kirche rollte, hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass die Renovierung der Stiftskirche in Baden-Baden nunmehr beendet ist. In naher Zukunft müsste also auch niemand mehr den Handwerker an seinen auf dem Transporter prangenden Werbespruch erinnern „Über hundert Jahre: Farbe im Blut“.
Lange genug hatte es ja gedauert, bis zum Frühling dieses Jahres nach dreijähriger Renovierungszeit eine der bedeutendsten Kirchen des Landes wieder geöffnet hat. Im Inneren ruhen vierzehn Markgrafen von Baden und ihre Angehörigen. Einer der Bedeutendsten war der Markgraf Philipp von Baden. Er war der fünfte Sohn des Markgrafen Christoph I und seiner Gattin Ottilie von Katzelnbogen, die insgesamt fünfzehn Kinder zur Welt brachte. Sie muss von zäher Konstitution gewesen sein, denn von den fünfzehn Kinder überlebten deren dreizehn.
Ihr Sohn Philipp scheint von eher schwächerer Natur gewesen zu sein, denn er litt an einer fortwährenden Darmstörung, die die Ärzte am Hofe nicht zu heilen vermochten. 1526 z.B., lag er wieder einmal siech darnieder. Ein Fachmann musste her, einer, von dem man sich Wunderdinge versprach. So einer wie Theophrastus Bombast von Hohenheim, besser bekannt unter dem Namen Paracelsus, der, von unbestrittener Kompetenz, sich zu der Zeit in Süddeutschland aufhielt und der es richten sollte. So habe er z.B. in Ingolstadt ein Mädchen geheilt, das gelähmt war. Nicht so viel Glück hatte hingegen Petrus von Burckhardis. Der war an seinem Asthma erstickt. In dem Fall war offensichtlich nichts mehr zu machen gewesen. Anders in Rottweil – da heilte er eine Äbtissin, die an Gürtelrose litt (derzeit kursierender Werbespruch: „Kann sehr belastend sein“).
Genug Empfehlungen also, nach dem Doktor zu schicken, der bald darauf wohl auch eintraf, um dem Markgrafen seine weithin gerühmte ärztliche Kunst angedeihen zu lassen. Und in der Tat war zu seiner Zeit Paracelsus das, was man eine Koryphäe nennt, ein Promidoktor, zu dem ‚man‘ ging.

Paracelsus – irgendwie frisch vom Frisör
Als einer der Ersten hatte er die Medizin auf eine neue Basis gestellt. Er studierte die Natur. „Umfasste sie nicht ein viel größeres Gebiet, als die Schulmedizin zuzugeben wagte?“ (H. Pächter „Paracelsus“) Der Mediziner schlug neue Behandlungswege ein, immer ausgehend von der zentralen Frage: was Krankheit eigentlich ist.
Wohl dem, der ihn in Zeiten der Not an seinem Krankenbett wusste. Wohl aber auch dem, der ihn nicht brauchte. Denn der Herr Doktor war ein rechter Zausel, der keiner Auseinandersetzung aus dem Weg ging, mit allen Streit anfing, dabei die Kollegen vor den Kopf stieß und allerlei mehr. Später, da war er schon weitergezogen nach Basel, berichtete sein Freund Oporinus in einem Brief, dass sich Paracelsus „dem Trunk und der Prasserei ergeben“ habe. „Die ganze Nacht…hat er sich nie ausgezogen, was ich seiner Trunkheit zuschrieb“.
„Dessen ungeachtet“ sei er, „wenn er am betrunkensten war“, zu seinem Schüler nach hause gekommen, um „mir etwas von seiner Philosophie zu diktieren“. In diesem Zusammenhang rühmte sein Schüler auch die Klarheit seiner Gedanken, „dass sie von einem nüchternen Menschen nicht hätten verbessert werden können“. Zudem hatte der Herr Doktor ein Schwert, das er bisweilen um Mitternacht wie ein Rasender aus der Scheide zog, es zu Boden schmiss, „so dass ich manchmal glaubte, er würde mir den Kopf abhauen“. So weit die Ausführungen des ‚Assistenten‘, das Verhalten seines Lehrmeisters betreffend, und man fragt sich unwillkürlich, warum heutzutage Assistenzärzte meine, sich über das Auftreten einzelner Chefärzte beklagen zu müssen.
Noch aber war es hier in Baden-Baden nicht so weit. Das war später, in Basel. Doch nun lag ein Fall vor, der die Behandlung des Besten bedurfte. Der Markgraf war krank, und zwar ernstlich. Und so schickte man nach dem Besten seiner Zunft, nach Parcelsus, der alsbald auch eintraf und mit der Fülle seiner Erfahrung konstatierte: dem Fürsten, der siech darniederlag, mache der Darm Probleme. Der Darm in seiner gereizten Form. Eine Darmreizung. So etwas würde zur Heilung Zeit brauchen. So verordnete er zunächst dem Markgrafen Ruhe und vor allem Geduld, beides solle die verabreichten Mittel ergänzen. Das allerdings würde sich hinziehen.
Ob der Markgraf jetzt auf einem guten Weg war? Möglich. Doch da hatte man nicht gerechnet mit den Medizinern vor Ort, die auf so einen wie diesen hergelaufenen Medicus gerade noch gewartet hatten, so einer, der sozusagen an ihnen vorbei den hohen Herren behandeln durfte. Die üblichen Eifersüchteleien also. Hinzu aber kam, dass sich der Hochgelahrte alsbald als das entpuppte, was er immer war: ein arroganter Rüpel, der sich der ortsansässigen Kollegen gegenüber so benahm, wie man es niedergelassenen Ärzten gegenüber besser nicht tut. Er wusste alles besser.
Die Schwachstelle der Behandlung war die Zeit, die sich Paracelsus ausbedungen hatte. Es solle gewartet werden, bis seine Mittel wirkten. Wunder dauern bisweilen etwas länger. Die Heilung brauche Zeit. Aber wie das bei Ärzten manchmal halt so ist: sie nehmen sich keine.
Offensichtlich hatte er aber nicht mit der Kamarilla gerechnet, die eifersüchtig geifernd um ihren Einfluss fürchtete und auch schon mal den avisierten Heilungsprozess hintertrieb. Er würde ihre Mittel als die seinen ausgeben, u.s.w. Sie geiferten weiter, intrigierten noch mehr.
Irgendwann wurde es wohl dem Markgrafen zu bunt, und so sah sich der Herbeigerufene ohne Entschädigung und Lohn entlassen, worauf der Herr Paracelsus verärgert das Weite suchte noch bevor die Krankheit den Patienten floh. Er verließ die Stadt, verbittert und sauer. Weiter zog es ihn nach Straßburg und von dort aus noch rief er unserem Fürsten hinterher: „Der Markgraf ist ein größerer Bescheißer als der Jud Messe von Thales“.