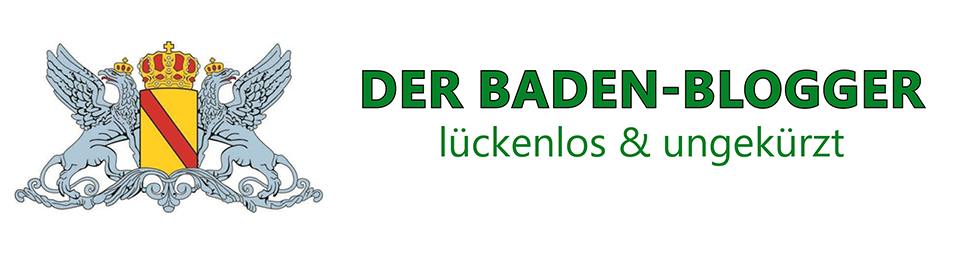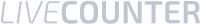Der Elsässer treibt’s manchmal ziemlich wild. Warum nur?
Wer in der Ortenau wohnt, hat vielleicht schon einmal mit dem Gedanken gespielt, den Sprung über den Rhein zu wagen. Dort, im Elsass, soll man ja echt gut wohnen. Hat ja auch eine Menge Vorteile. Zumindest früher – so hieß es – stellte man sich steuerlich günstiger. Auch heute liegen die Vorteile noch auf der Hand. Z.B. beim Käse. Verglichen mit den Preisen bei uns ist er deutlich billiger. Und dann der Fisch und der Wein. Davon brauchen wir erst gar nicht zu reden. Und auch noch die Natur! Platz, soweit das Auge reicht.
Dies alles führte dazu, dass sich im Elsass regelrecht deutsche Kolonien gebildet haben, Wagenburgen des Deutschtums (wir haben darüber berichtet. (http://www.badenblogger.de/dornen-im-paradies-teil-1/2)
 Wer aber keinen Platz mehr gefunden hat in der dortigen Deutsch – Kolonie ‚Chalets du Lac’, der nimmt vielleicht mit einem jener kleinen Häuschen vorlieb, deren letzte Bewohnerin erst kürzlich verstorben, jetzt einen neuen Besitzer suchen. Fachwerk, niedrige Decken, Gärtchen hinterm Haus. Preiswert aber renovierungsbedürftig. Und das mitten im Ort. Toll. Und ruhig. Sehr ruhig. In den kleinen Dörfern nahe der Rheinebene herrscht nach 18 Uhr Stille. Jenseits der touristischen Zentren – Riquewihr, Obernai, Wissembourg – geht das Leben seinen überaus gemächlichen Gang, abendliche Ruhe eingeschlossen. Niemand lärmt. Nicht einmal eine Kneipe gibt es am Ort. Die Rollläden werden nach 19 Uhr runtergelassen. Und gibt es im Dorf überhaupt noch ein Restaurant, dann sollten es schon ein paar Menues sein, wg deren der Wirt ausnahmsweise etwas länger geöffnet hat.
Wer aber keinen Platz mehr gefunden hat in der dortigen Deutsch – Kolonie ‚Chalets du Lac’, der nimmt vielleicht mit einem jener kleinen Häuschen vorlieb, deren letzte Bewohnerin erst kürzlich verstorben, jetzt einen neuen Besitzer suchen. Fachwerk, niedrige Decken, Gärtchen hinterm Haus. Preiswert aber renovierungsbedürftig. Und das mitten im Ort. Toll. Und ruhig. Sehr ruhig. In den kleinen Dörfern nahe der Rheinebene herrscht nach 18 Uhr Stille. Jenseits der touristischen Zentren – Riquewihr, Obernai, Wissembourg – geht das Leben seinen überaus gemächlichen Gang, abendliche Ruhe eingeschlossen. Niemand lärmt. Nicht einmal eine Kneipe gibt es am Ort. Die Rollläden werden nach 19 Uhr runtergelassen. Und gibt es im Dorf überhaupt noch ein Restaurant, dann sollten es schon ein paar Menues sein, wg deren der Wirt ausnahmsweise etwas länger geöffnet hat.

 Doch warten die Dörfer noch mit etwas ganz anderem aus, das der Neubürger so nicht kennt. Das wird ihm ganz besonders auffallen, wenn die herbstlichen Rheinnebel sich langsam über die Fluren legen. Die Schatten kommen, das Grau wird zur allesbestimmenden Farbe. Und doch findet der Elsässer immer wieder heim.
Doch warten die Dörfer noch mit etwas ganz anderem aus, das der Neubürger so nicht kennt. Das wird ihm ganz besonders auffallen, wenn die herbstlichen Rheinnebel sich langsam über die Fluren legen. Die Schatten kommen, das Grau wird zur allesbestimmenden Farbe. Und doch findet der Elsässer immer wieder heim.
Das liegt an der Farbe, mit der er sein Anwesen gestrichen, nein besser, kenntlich gemacht hat. Ja, man darf sagen: er pflegt ein völlig unverkrampftes Verhältnis zum Häuseranstrich. Keine Farbe, egal, wie grell oder blendend, die sich nicht an den Außenwänden der Häuser wiederfindet. Überreichlich aufgetragen soll wenigsten der Außenanstrich etwas Freude in die an sich eher tristen Dörfer der elsässischen Rheinebene zaubern.
Grellrot, Giftgrün, Aquamarinblau? Bienengleich erkennt der Grenzbewohner schon beim Anflug: da bin ich daheim. Darin gleicht der Elsässer der Biene.
Wie sie, verlässt sich auch er auf grelle Signalfarben, will er nach getaner Arbeit seine Heimstatt wiederfinden.
Vielleicht ist es diese einzigartige Mischung aus deutschem und französischem Volkscharakter, das den Elsässer auszeichnet. Zum einen ähnelt er in seinem bienenhaften Fleiß dem Badener. Dies wäre vielleicht ein Grund, seine Heimstatt wie ein Bienenstock aussehen zu lassen.
Andererseits aber könnte sich in dieser wilden Farbgebung ein Stück weit auch die anarchische Haltung des Franzosen ausdrücken, der sich in  bestimmten Bereichen von keiner staatlichen Stelle vorschreiben lassen möchte, wie er sein Haus anzustreichen hat.
bestimmten Bereichen von keiner staatlichen Stelle vorschreiben lassen möchte, wie er sein Haus anzustreichen hat.
Und dabei schreckt er vor nichts zurück. Nicht einmal davor, seine vier Wände in Ochsenblut zu tauchen.