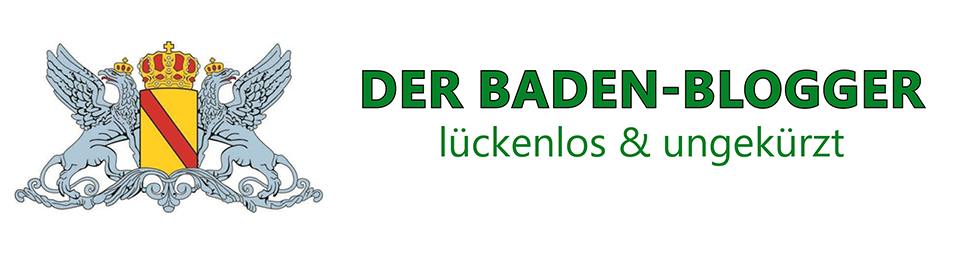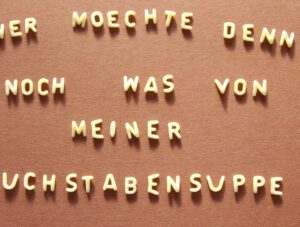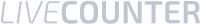Warum wollen alle Dichter aus ihren Werken laut vorlesen?
Eine Bekannte von mir schreibt kleine Geschichten. Diese handeln meist vom alltäglichen Leben. Es kommen darin Kinder vor, Nachbarn. Aber auch Dinge, die ihr auffallen, sie ärgern, amüsieren. Manchmal sind diese Geschichten lustig, öfter aber auch mal traurig. In jedem Fall sie sind gut zu lesen, zumal in den Geschichten kaum Fremdwörter vorkommen. So muss man selten Wörter nachschlagen, die man noch nicht kennt. Kurz, es spricht nichts gegen dieses Hobby, das uns, gibt sie uns diese Geschichten zum lesen, richtig Freude macht.
Nun muss ihr aber irgendjemand den Floh ins Ohr gesetzt haben, dass man diese Texte auch öffentlich vortragen kann. Das wäre an sich ja noch nichts Besonderes, hätte sie nicht einen recht großen Freundeskreis, bei dessen Anlässen sie neuerdings irgendeine Geschichte „zum Vortrag bringen könnte“ – so die Formulierung, mit der so eine Lesung meist etwas umständlich angekündigt wird.
Der Aufwand bei so einer Lesung ist ja überschaubar. In der Regel braucht sie einen Stuhl, einen kleinen Tisch, und – ganz wichtig – eine Lampe. Was sie immer schön findet ist zudem eine Blumenvase mit ein paar Blümchen drin, die sie im Laufe des Vortrags immer mal wieder liebevoll betrachtet.
Nun mag der Leser (oder in seiner weiblichen Form die ‚Leserin‘) einwenden, was dagegen spreche, dass jemand Geschichten schreibt und diese auch noch vorliest. Da muss ich sagen: eigentlich nichts. Die Vortragende liest in der Regel ja nicht laut, niemand hat Anlass, sich gestört zu fühlen. Auch wird die Luft nicht verschmutzt; die Vortragende (wie im vorliegenden Fall) liest ja nicht im Fahren.
Soweit so gut.
Jetzt aber kommt das große Aber. Meine Bekannte liest schlecht. Das ist kein Problem, wenn jemand einem anderen mühsam die Schrift einer unleserlichen Postkarte dechiffriert. Anders wiederum verhält es sich, wenn eine noch ziemlich unbekannte Dichterin mit vergleichsweise großer Euphorie aus eigenen Werken vorträgt, von denen man vortragsbedingt wünscht, dass das Werk gefälligst bald aufhöre. Meist liest sie etwas hastig, manchmal aber schleppt sie auch. Und immer wieder kommt es vor, dass sie vom selbst gesetzten Komma überrascht scheint. An anderer Stelle wiederum scheint diese den Satz gliedernde Hilfe schmerzlich vermisst zu werde. Manchmal geht ihr sogar die Luft aus, bevor der offensichtlich zu lange Satz endlich ein Ende findet. Dann kuckt sie schon etwas früher zu den Blumen in der Vase.
Nun ist sie nicht die einzige, die sich in der Kunst des Vortrags gefällt. Die Kulturwelt ist voll davon. So auch in Klagenfurt anlässlich des „Ingeborg Bachmann Preises“, bei dem es in der Regel zu schwer verdaulichen Darbietung von an sich nicht einfacher Literatur handelt. Wer sich jemals der Tortur unterzogen hat, so eine Lesung im Fernsehen zu verfolgen, der fragt sich, warum sich die LiteratenInnen dort nicht nur traditionell zum Schwimmen in den Wörthersee begeben, sondern die Texte durch ihren Vortrag anlassbedingt auch noch gleich mit versenken.
Doch sollte man eine so schwere Kritik nicht ohne Erwähnung des besser Möglichen in den Raum stellen. Als beispielhaft gute Vortragende eigener literarischer Hervorbringungen dürfen z.B. gelten Günter Grass, Ernst Jandl und Walter Jens. Aber das sind wahrhaft rare Ausnahmen. Der Rest ist besser Schweigen.
Es mag die vortragenden DichterInnen schmerzen. Sie schaden ihren Texten durch ein Vortragen eigener Texte meist mehr als dass sie diesen nützen. So könne es z.B. sein, dass der Text keineswegs so einfach gebaut ist, wie der Schöpfer sich das vorstellt. Der Prozess des Hervorbringens ist meist komplex, und selten macht sich der Verfasser die Mühe, das Fabrizierte sich selbst laut vorzulesen. Max Brod erzählte, dass Kafka seiner Texte vorgelesen hätte, allerdings immer nur im Kreise seiner drei Prager Freunde. Flaubert hingegen liebte den Vortrag laut. Von ihm ist bekannt, dass er jeden einzelnen Satz seine ‚Madame Bovary‘ laut aus dem Fenster gebrüllt hätte. Verständlicherweise ist dann daraus ja auch große Literatur geworden!
So weit geht meine Bekannte nicht. Sie wohnt eher beengt und muss fürchten, dass ein lautes Deklamieren die Nachbarn stört. Aber vielleicht ist der Text tatsächlich so einfach nicht, wie die Verfasserin es sich vorstellt, und kein Mitbewohner rät dann dazu, das Gebotene schlichter zu fassen, ggf klarer zu strukturieren. Das Ergebnis ist dann so, wie ich es eben beschrieben habe.
Und in der Tat ist das eine oder andere Werk tatsächlich schwer vorzutragen. So hat man nie davon gehört, dass z.B. Arno Schmidt je aus ‚Zettels Traum‘, oder James Joyce aus dem ‚Ulysses‘ gelesen hätte. Auch Marcel Proust hätte bei seinem Opus Probleme gehabt, Sätze, die sich über eine halbe Seite erstrecken, schlüssig zu vermitteln. Muss ja auch nicht sein, wenn man seine Fähigkeiten aufs Literarische beschränkt. Aber auch die Schöpfer anderer Kunstwerke übten sich in angebrachter Bescheidenheit. Ist z.B. jemandem zu Ohren gekommen, dass Rembrandt etwa „Die Nachtwache“ erklärt oder Wagner aus eigenen Opern vorgesungen hätte? Eben.
Heute Abend also wieder so ein Vortrag meiner Bekannten. Natürlich liest sie aus eigenen Werken. Man erwartet mich. Ich werde zeitig da sein. Es gibt Kaffee und Kuchen.