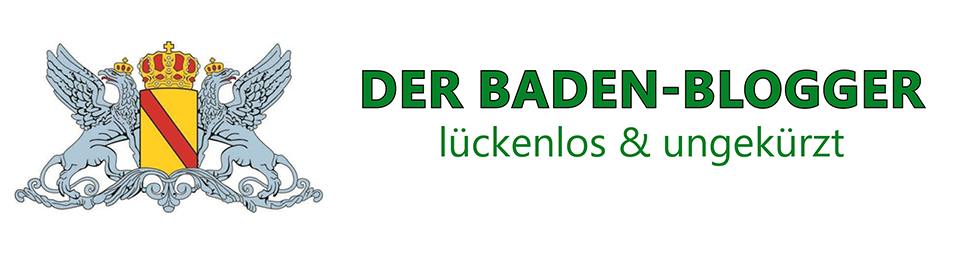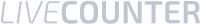Einmal dabei: zum Konzert in die Isarphilharmonie
Ich gehe gern ins Konzert, wobei ich sagen muss, dass mich das Symphonische ganz besonders anspricht – vor allem natürlich dann, wenn ich eingeladen bin. Gestern z.B. war wieder einmal so ein Tag, der es gut mit mir meinte. Das freute mich ganz besonders, weil die Konzertkarte stolze € 81 gekostet hätte. In so einem Fall genieße ich das natürlich doppelt, vor allem, weil das ja nicht alltäglich ist. Freilich sollte man -auch wenn man eingeladen ist – etwas dafür bekommen.
Versprochen war ein Konzert des Symphonieorchesters des Bayrischen Rundfunks unter der Leitung von Simon Rattle. Freunde gepflegten Orchesterklangs dürfte er bestens bekannt sein, schon allein wegen seiner Frisur, die, eine Überfülle weißgelockter Haare, auch die Hülle seiner Schallplatten ziert. Man könnte sie durchaus als ein Markenzeichen von ihm bezeichnen, zumal sie ihm sowohl auf der Plattenhülle als auch beim Auftritt gut zu Gesicht steht. Dies dürfte auch am englischen Königshof nicht ganz unbemerkt geblieben sein, denn man hatte ihm – auch seiner enormen Musikalität wegen – schon vor geraumer Zeit den Titel ‚Sir‘ verliehen. An besagtem Abend also dirigierte Sir Simon Rattle.
Stilistisch betrachtet gab’s Spätromantisches. Berlioz, Debussy und Ravel. Dazu kam das Werk des nicht so bekannten Charles Koechlin. Dem Namen nach Elsässer, war er aber doch – wie ich dem Programmheft entnahm – ein waschechter Franzose, was einmal mehr unterstreicht, dass der Erwerb eines Programmheftes eine sinnvolle Investition sein kann. Dort war er zudem als „Stilles Genie unter Krachmachern“ angekündigt, was aber nicht ganz stimmte. An b1esagtem Abend verdankten wir ihm das lauteste Stück!
Dass ich das so empfand, lag ein Stück weit auch an meinem Sitzplatz in der 4. Reihe. Die Reihen 1-3 waren gar nicht vorhanden, weshalb dort, wo die Reihe 1 hätte sein müssen, schon das Orchester saß, das nun begierig darauf wartete, sich unter die ‚Stabführung‘ des Maestro zu begeben. Das Orchester war erstaunlich groß. Allein sieben Streichbässe! Manch einer mochte sich fragen, ob’s ein oder zwei Bässe weniger nicht auch getan hätten. Jedenfalls gab es an diesem Abend ungewohnt viele Musiker für vergleichsweise wenig Geld.
Das Programmheft hatte dem Dirigenten im Vorfeld „Bezwingendes Charisma“ bescheinigt, doch als er dann endlich aus der Kulisse trat und hochdynamisch dem Podest zustrebte, kam er – die Höhe falsch einschätzend – beim Ersteigen des Podests fast zu Fall. Dass so etwas einem erfahrenen Dirigenten passiert!
Er hatte sich aber schnell wieder gefasst, und so konnte das Konzert mit Berlioz’ ‚Romeo et Juliette’ beginnen, ein Stück, dessen Interpretation ein Kritiker später als bezwingend lobte und dessen wuchtiger Klang noch dem letzten Besucher klarmachte, wofür man die enorme Menge an MusikantInnen aufgeboten hatte – von den sieben Bässen gar nicht zu reden. Wunderbar auch, dass man endlich einmal die Harfe zu sehen bekam. Normalerweise versteckt man das an sich doch schöne Instrument im Orchestergraben. Und auch eine Harfenistin war zu sehen, die, wie oft genug, keineswegs blass und blond war, sondern die Zuhörer mit lebendigem Teint und dunklem Haar für sich einnahm. Gut zu sehen auch, dass sie bei diesem Repertoire alle Hände voll zu tun hatte.
 Meiner vorgeschobenen Sitzposition verdankte ich außerdem eine klare Sicht auch eine ca 40 jährige Violonistin, die in meinem unmittelbaren Blickfeld musizierte und als eine der wenigen, soweit ersichtlich, keinen schwarzen Punkt am Kinn hatte, eine Art Druckstelle, die, so versicherte man mir, in der Regel auf fleißige Übungtätigkeit verweist. Über weite Strecken geigte sie überaus engagiert auf. War sie musikalisch nicht gefordert, lugte sie ganz entspannt in die Gegend. Ein klarer Hinweis darauf, dass die wahre Arbeit so einer Geigerin im häuslichen Kreis stattfindet.
Meiner vorgeschobenen Sitzposition verdankte ich außerdem eine klare Sicht auch eine ca 40 jährige Violonistin, die in meinem unmittelbaren Blickfeld musizierte und als eine der wenigen, soweit ersichtlich, keinen schwarzen Punkt am Kinn hatte, eine Art Druckstelle, die, so versicherte man mir, in der Regel auf fleißige Übungtätigkeit verweist. Über weite Strecken geigte sie überaus engagiert auf. War sie musikalisch nicht gefordert, lugte sie ganz entspannt in die Gegend. Ein klarer Hinweis darauf, dass die wahre Arbeit so einer Geigerin im häuslichen Kreis stattfindet.
In den stilleren Passagen des Werks fand die Muse, mich umzudrehen und die hinter mir sitzenden Konzertbesucher einmal näher zu betrachten. So kam ich nicht umhin, eine vergleichsweise hohe Dichte fernöstlicher Besucher zu konstatieren. Bei abschwellendem Orchesterlärm erstaunte mich das derart, dass ich mich fragte, ob China angesichts dieser enormen Verluste an Menschen nicht fast leer sein müsse? Nicht genug! Es gab sie auch im Orchester. In den kurzen Pausen des Werks, fragte ich mich bisweilen, was diese fernöstlichen Musiker bei so einem Werk fühlen und warum es sie deswegen in den Westen treibt. Was hat Musiker und Zuhörer aus dem fernen Kulturkreis bewogen, über den Rand ihrer Teetassen hinauszublicken und sich an die Isar aufzumachen? Was hören sie da? Sie, die vom Reis in dünnwandigen Schüsselchen groß geworden, hatten in Vorzeiten anlassbezogen noch „Tora, Tora“ gerufen; heute sitzen sie hier im Westen, um Musikern in speckigen schwarzen Anzügen mit Schwalbenschwänzen zuzujubeln. Was macht das mit ihnen, haben sie tausende von Euro ausgegeben, um z.B. anlässlich des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker im Publikum zu sitzen? Warum macht es sie Stolz, sehen sie ihre Töchter beim Wiener Opernball übers Parkett schweben? Erinnert sie das an den langen Marsch? Rätselhafter ferner Osten!
„Ungeheuer schwierig aufzuführen“, so stand es im Programmheft. Verständlich, dass nach „Romeo et Juliette“ sowohl den Musikern als auch den Konzertbesuchern der Sinn nach einer Pause stand, über die hier nicht viel erzählt werden soll.
Zu groß war die Spannung bezüglich des noch folgenden Programms. Versprochen war noch Claude Debussy’s „Jeux“, weiter den oben bereits angeführten Charles Koechlin und, als Abschluss: Maurice Ravel, von dem man sich natürlich fragte, ob er gut ausgehen würde. Und in der Tat endete der Konzertabend so, wie man es sich wünscht. Von dem Wunsch beseelt, das Publikum nicht gänzlich zu verschrecken, hält man es üblicherweise für geboten, ein noch so dissonantes Programm versöhnlich enden zu lassen, am besten mit einem Walzer, oder, wie im vorliegenden Fall mit dem ‚La valse‘ von Ravel. Zwar bescheinigt das Programm dem Schluss des Werkes ein „fataler (…) fratzenhafter Abgang auf ein ganzes Jahrhundert“.
Aber die meisten Besucher werden gedacht haben: besser als nichts. Großer Beifall.