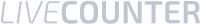Daniela Lipps rettet, was zu retten ist: Bücher
Daniela Lipps rettet, was zu retten ist: Bücher
Es sind vor allem die Farben. Zunächst das gedeckte, schon leicht ausgewaschene Grün der Fassade. Dann eine französische Fahne, die müde und verblichen vor dem schönen, alten Haus an der Luisenstraße, steht. Gegenüber der Trinkhalle. Die Fahne erinnert daran, dass Baden-Baden früher einmal, in den Zeiten des Herrn Benazet, eine sehr französische Stadt war. Die Hausnummer 30 hatte vormals ein Blumengeschäft beherbergt, das aber seit langem geschlossen ist, und rückblickend selten farbenfrohe Rosen, Nelken oder Tulpen im Verkauf hatte, dafür aber Vergissmeinnicht, Calla und auch Lilien, alles, was man für Beerdigungen halt so braucht.
Das hat sich seitdem geändert. Jetzt, da dort seit mehreren Jahren eine Buchbinderei eingezogen ist, schmücken ein Gummibaum und die Grünlilie das Schaufenster, deren weiß-grüne Blätter farblich ja auch nicht so der Knaller sind. Was ja vielleicht auch nicht unbedingt zu dem kontemplativen Gewerbe passen würde, dem Daniela Lipps, achtunddreißig Jahre alt, dort nachgeht. Ihre Welt sind die Bücher, meist der älteren Art. Antiquariatsbücher. Manche verstaubt oder vergilbt. Soweit ihr möglich restauriert sie diese, bindet sie neu oder ordnet sie, wie z.B. die Monatsschriften der hier ansässigen Rechtsanwaltskanzleien.
Das ist jetzt ihre Welt. Sie ist Baden-Badenerin. Nach einer dreijährigen Ausbildung in der Unibibliothek in Kaiserslautern geht sie nach Freiburg, um dort Mathematik zu studieren. Von dort kehrt sie diplomiert zurück und übernimmt ein Buchbindergeschäft in Lichtental, bevor sie in der Innenstadt ihr jetziges Geschäft findet. Richtet sie ihren Blick nach draußen, durch das weißgestrichene Gitter ihrer Eingangstür, blendet sie das Grün der Lichtentaler Allee.
Das passt ihr so. So wie es ist. Das stille Werken am Vergangenen. Sie ist eher zurückgenommen und sieht sich ungefragt als Einzelgängerin. Das Innere des Werkraums ist zwangsläufig – buchdeckelgemäß – ebenfalls in gedeckten Farben gehalten. Braun. Grau. Beige. Viel Papier dort, gestapelt, wartet darauf verarbeitet zu werden. Dazwischen alte Buchbindemaschinen, Pressen, Papierschneider. Von außen betrachtet wirkt das Innere wie eine Höhle, und erstaunt registriert man, von draußen ins Innere blickend, einen weißen Arm, der im Licht einer Schreibtischlampe seinem konzentrierten Tagwerk nachgeht.
Dabei kann sie nach eigener Aussage gut mit Leuten. Wenn sie muss. Und hat nichts dagegen, wenn sie nicht muss. Sie ist das Gegenteil von exaltiert. Im heutigen Zeitalter der Selbstentblößung wirkt sie unzeitgemäß zurückgenommen.
Fernseher? Hat sie nicht. Viele Hörbücher, ja, das mag sie. Musik auch, aber nicht zu viel. Sie geht nach Hause und hat trotzdem Kontakt mit anderen. Sie chattet dann. Wenn es ihr zu viel wird, schaltet sie den Rechner ab. So einfach ist das. Alles unter Kontrolle.
Das mit dem Chatten werden vielleicht nicht alle ihrer Kunden so einfach verstehen. Vor allem nicht diese, die ein zu restaurierendes Buch gern zum Anlass eines längeren gepflegten Gesprächs nehmen.
 Man wird dem Klientel nicht Unrecht tun, wenn man es als eher konservativ bezeichnet. Daniela Lipps vermutet angesichts dessen, was ihr so täglich zum Binden vorbeigebracht wird, wertvolle private Bibliotheken hinter gediegenen Mauern. Dass diese Kundschaft in ihr eine Verbündete im Bildungsbürgerlichen sieht ist ihr klar. Das nimmt sie, die Tochter eines linken Lehrerehepaares, in Kauf und versucht, soweit ihr möglich, sich etwaige Bildungsdefizite nicht anmerken zu lassen.
Man wird dem Klientel nicht Unrecht tun, wenn man es als eher konservativ bezeichnet. Daniela Lipps vermutet angesichts dessen, was ihr so täglich zum Binden vorbeigebracht wird, wertvolle private Bibliotheken hinter gediegenen Mauern. Dass diese Kundschaft in ihr eine Verbündete im Bildungsbürgerlichen sieht ist ihr klar. Das nimmt sie, die Tochter eines linken Lehrerehepaares, in Kauf und versucht, soweit ihr möglich, sich etwaige Bildungsdefizite nicht anmerken zu lassen.
Die Kundschaft scheint sich an ihrem Äußeren jedenfalls nicht zu stören. Die Rastafari-Locken, die von ihrem Kopf wie teils geknickte Antennen abstehen, sind ja erscheinungsmäßig auch nicht mehr das Aktuellste. So weißt die Rastafari-Bewegung, in den dreißiger Jahren entstanden, durchaus alttestamentarische Züge auf. Vielleicht ist es das, weshalb die Frisur von Daniela Lipps ihren bildungsbürgerlichen Kunden so seltsam vertraut vorkommt? Und hätten sie den Blick gesenkt, wäre ihnen womöglich auch noch aufgefallen, dass sie ihre Zehennägel, die aus ihren Gesundheitsschuhen lugen, in je verschiedenen Farben lackiert hat. Aber auch diese Farben sind gedeckt.
Man wird das Bild des Diogenes in der Tonne nicht überstrapazieren, wenn man konstatiert, dass sich da eine junge Frau in der Jetztzeit so eingerichtet hat, dass sie von ihrem Geschäft “grad so lebt“. Sie hat keine großen Ansprüche, kommt „eben so rum“. Aber auch dabei ist sie auf unaufdringliche Art reduziert. Sie würde damit nie hausieren gehen. Dass sie ein Selbstvermarktungsproblem hat, weiß sie. Gern würde sie mehr aus sich rausgehen. Noch geht das nicht, aber sie arbeitet daran. Am liebsten wäre ihr, da wäre jemand, der ihr den Kontakt mit dem Publikum abnimmt. Glücklich sähe sich dann in einem kleinen Arbeitskäfig, davor ein Schild: „Buchbinder. Bitte nicht füttern“.
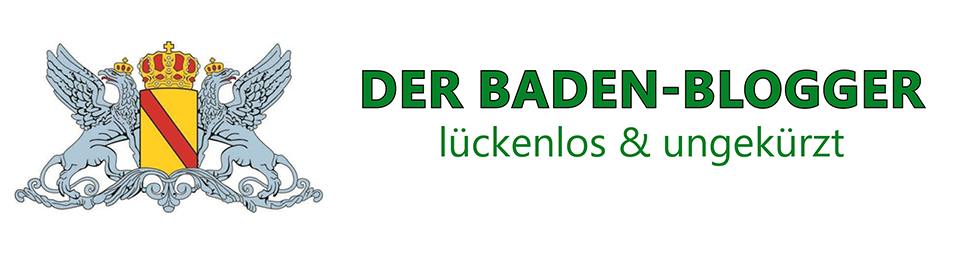








 t es einmal mehr gerade der Tag des offenen Denkmals, am kommenden Sonntag, den 13. September, an dem die Veranstalter des Steinbacher Moped-und Motorradtreffens , zum nunmehr 3. Mal zu einem großen Treffen laden. Das fröhliche Knattern beginnt um 10 Uhr und endet um 17 Uhr. Die Veranstaltung findet statt auf dem Gelände des Autohauses Karcher in Steinbach. Der Eintritt ist frei. Startgebühr wird keine erhoben.
t es einmal mehr gerade der Tag des offenen Denkmals, am kommenden Sonntag, den 13. September, an dem die Veranstalter des Steinbacher Moped-und Motorradtreffens , zum nunmehr 3. Mal zu einem großen Treffen laden. Das fröhliche Knattern beginnt um 10 Uhr und endet um 17 Uhr. Die Veranstaltung findet statt auf dem Gelände des Autohauses Karcher in Steinbach. Der Eintritt ist frei. Startgebühr wird keine erhoben.