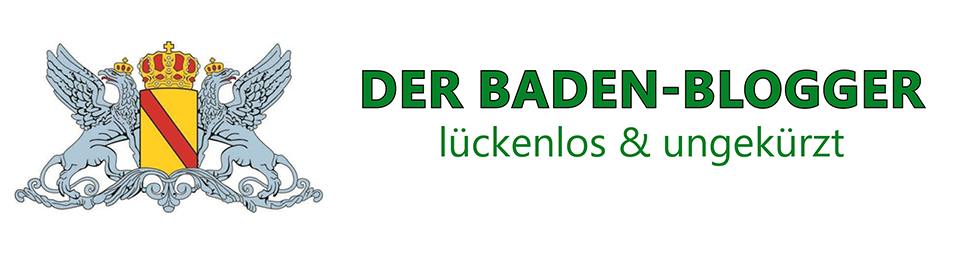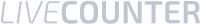Wie immer um einen passenden Vergleich ringend, formulieren wir es jetzt mal so: wie eine üppige Fischpopulation auf gute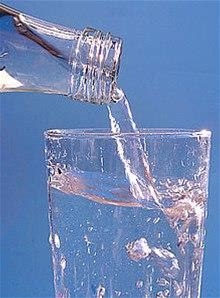 Wasserqualität verweist, so zeugt ein hoher Anteil von Frauen in Lokalen und Kneipen auf ein gut geführtes Haus. Spätestens da wird offensichtlich, dass es sich um keine dumpfe Bierwirtschaft handelt, wo Altlinke etwa der vergangenen Revolution nachtrinken, sondern es zeigt sich, dass an diesen Tischen die Neuzeit in ihrer emanzipatorischen Form Einzug gehalten hat. Recht so!
Wasserqualität verweist, so zeugt ein hoher Anteil von Frauen in Lokalen und Kneipen auf ein gut geführtes Haus. Spätestens da wird offensichtlich, dass es sich um keine dumpfe Bierwirtschaft handelt, wo Altlinke etwa der vergangenen Revolution nachtrinken, sondern es zeigt sich, dass an diesen Tischen die Neuzeit in ihrer emanzipatorischen Form Einzug gehalten hat. Recht so!
Allerdings müssen wir in unserem fortgesetzten Bemühen um eine ausgewogene Sichtung darauf hinweisen, dass das, was wir oben so süffig formuliert haben zugleich auch seine Schattenseiten hat. Natürlich muss jeder modernen Frau das Recht zugestanden werden, in der Gastronomie ihren Platz zu finden. Doch wird man dieses Recht nicht grundsätzlich in Frage stellen, wenn man darauf verweist dass eine gute Frauenbelegung dem Umsatz nicht unbedingt in dem Maß zuträglich ist, wie ein – sagen wir mal – euphorisch gestimmter Männerstammtisch. Dies liegt zum Großteil am üblicherweise gepflegten Zeitmanagement, was sich schon daran zeigt, dass an Frauentischen enorm viel Zeit verplempert wird durch ein unvorstellbar aufwändiges Begrüßungsritual.
Während der erfahrene (männliche) Stammgast bereits beim Betreten des Lokals durch eine kleine unscheinbare Geste dem Personal kundtut, dass er das Übliche nimmt, verplempert die schon anfänglich heiter gestimmte Frauengruppe lange vor der eigentlichen Bestellung viel Zeit mit einem aufwändigen Begrüßungsritual. Selbst wenn der Tisch bereits voll besetzt ist, fordert es ein ungeschriebenes Gesetz, dass die eben Eingetroffene jede der Freundinnen einzeln herzt, was durch ein Auf- und Abstreicheln des Rückens geschieht und Vertrautheit, ja, menschliche Nähe suggeriert. Unabdingbar für den Empfang der Streicheleinheiten dabei ist allerdings, dass alle, die sich bereits gesetzt hatten, noch einmal aufstehen, um sich, nunmehr hinter dem Tisch hervorgekommen, dem Prozedere zu unterziehen.
Da die Gruppe das Aufhängen von Mänteln an der vorgesehenen Garderobe nicht ernstlich in Betracht zieht, ist kaum zu vermeiden, dass grellfarbige Kunstpelze, aber auch lustige selbstgestrickte Mützen (mit Öhrchen) und Schals aus Ländern ohne funktionierende Zivilgesellschaft von der Stuhllehne rutschen, worauf der Stuhl vor der herzlichen Wucht der Begrüßungszeremonie kapituliert und umfällt.
Überflüssig zu erwähnen, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine Bestellung abgegeben wurde, weshalb unnötige Zeit verstrichen ist. Obwohl ein eventuell zu erwirtschaftender Umsatz lediglich mit Mineralwasser erzielt, also denkbar gering sein wird, gelingt es den weiblichen Gästen schon vor der eigentlichen Konsumation mühelos, durch hochfrequenzige Lärmerzeugung (Lachen. Quieken. Kichern.) jeden Männerstammtisch um Dezibel zu übertönen.
Ist der Lärm an sich schon enorm, kann er allerdings noch gesteigert werden durch das Zuführen auch kleinster Mengen Alkohol. Selbst das Nippen an einem normalen Gläschen Sekt – der traditionelle Aufwärmer – reicht vollständig aus, um die Anwesenden glauben zu machen, die Stimmung habe sich schon früh dem Siedepunkt genähert. Das wäre dann wie Kochen ohne Wasser.
Nüchtern betrachtet könnte es also auf einen Vergleich etwa dergestalt zulaufen: ein fideler Frauenstammtisch auf Mineralwasserbasis – das ist etwa so, als sei der Kölsche Karneval letztlich nur eine Illusion, hervorgebracht durch das Hochwerfen eines einzelnen Konfetti-Schnipsels.
ÄHM – – –
Ja, gut: der letzte Sommer ist nun schon eine ganze Weile her. Das sollte uns aber gerade angesichts der derzeitigen Wetterlage nicht davon abhalten, einen letzten wehmütigen Blick auf ein Highlight der längst vergangenen Sommersaison werfen: das Speiseeis in seiner je verschiedenen Geschmacksrichtung.
Nachdem uns schon vor Jahren die Nachricht von einem kulinarischen Knaller erreicht hatte (ein Speiseeis auf Lebenwurstbasis für Hunde – wir berichteten darüber), möchten wir in diesem kleinen Rückblick auf eine weitere gefrorene Fußnote zu sprechen kommen. Sie hatte in der Nähe von Baden-Baden ihren Ausgang genommen und war als eine Art Hilfestellung gedacht. Denn seinen wir ehrlich: wen beschleicht vor einer Eistheke (wir erinnern uns?) nicht einen gewisse Ratlosigkeit angesichts der vielen Köstlichkeiten, die hier feilgeboten werden? Welche Sorte soll man denn nehmen?
Niemand sollte sich in dieser Situation wundern, wenn der Genießer kurz innehält, um sich über das, was jetzt gleich in die Waffel soll, einen Überblick zu verschaffen. Es ist der Moment, an dem es gilt, die verschiedenen Geschmacksrichtung am Gaumen vorbei ziehen zu lassen. Dieser Prozess des Innehaltens wird für gewöhnlich durch ein nachdenkliches ‚ Ähm‘ unterstrichen.
Kein Wunder, dass eben das im badischen Gaggenau ein findiger Italiener zum Anlass genommen hatte, eine Eissorte nach diesem Wortzombie zu benennen. Wer also im vergangenen Sommer vor den Tresen besagter Eisdiele trat und seiner Unentschlossenheit mittels dieses kleinen Wortes Ausdruck verlieh, bekam eben das: eine Kugel ‚Ähm‘. Weiße Schokolade mit ‚Pistazien-Crunch‘. Man könnte also sagen: wem in diesem Moment nichts Besseres einfiel, sagte einfach mal ‚Ähm‘ und war fürs erste gut bedient.
Dieses ‚Ähm´ als Ausdruck geistiger Ratlosigkeit ist seit längerem nun aber auch in anderem Umfeld in Gebrauch. Und zwar im Umfeld unseres staatstragenden Senders Deutschlandfunk (DLF), wo man sich überaus korrekt und staatstragend gibt. Fortwährend sehen sich dort Politiker oder Referenten sogenannter „Thinktanks“ eingeladen, um sich tagsüber aber auch nachts zu je verschiedenen Themen zu äußern.
Unser gaggenauer Eismacher offeriert im Schnitt 40 Eissorten. Da mag die Auswahl schwerfallen. Anders als im Programm des DLF, wo das Angebot in der Regel deutlich kleiner ist und man sich auf seinen Qualitätsjournalismus trotzdem sehr viel zugute hält. Ähnlich wie vor der Eistheke ist auch dort, auf dem Flaggschiff publizistischen Denkens, der Sprachfluss fortwährend durchsetzt mir formelhaften ‚Ähms‘. Ja, man könnte sagen: wem im Moment auch dort nichts einfällt, der greift mündlich gern zum ‚Ähm‘.
Da trifft es sich schon gut, dass wie jedes Jahr die Medien sich auch im vergangenen Jahr auf die Suche nach dem Jugendwort des Jahres gemacht haben. Zur Auswahl standen so Ausdrücke wie „goofy“, „Auf Lock“ oder „Riss“, die hier in ihrer Bedeutungsschwere nicht weiter Beachtung finden sollen.
Doch muss man sich schon wundern, dass keiner der Maßgeblichen das ‚Ähm‘ in die nähere Auswahl genommen hatte.
Das hätte wenigsten allen geschmeckt.
„…ein größerer Bescheißer“
Wie Paracelsus einmal unseren Markgrafen beschimpfte
Der Frühling kommt. Der Maler geht. Ein rundum gelungener Abschluss? Als der kleine weißlackierte Transporter der Firma Dieterle aus Forbach vom Parkplatz vor der Kirche rollte, hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass die Renovierung der Stiftskirche in Baden-Baden nunmehr beendet ist. In naher Zukunft müsste also auch niemand mehr den Handwerker an seinen auf dem Transporter prangenden Werbespruch erinnern „Über hundert Jahre: Farbe im Blut“.
Lange genug hatte es ja gedauert, bis zum Frühling dieses Jahres nach dreijähriger Renovierungszeit eine der bedeutendsten Kirchen des Landes wieder geöffnet hat. Im Inneren ruhen vierzehn Markgrafen von Baden und ihre Angehörigen. Einer der Bedeutendsten war der Markgraf Philipp von Baden. Er war der fünfte Sohn des Markgrafen Christoph I und seiner Gattin Ottilie von Katzelnbogen, die insgesamt fünfzehn Kinder zur Welt brachte. Sie muss von zäher Konstitution gewesen sein, denn von den fünfzehn Kinder überlebten deren dreizehn.
Ihr Sohn Philipp scheint von eher schwächerer Natur gewesen zu sein, denn er litt an einer fortwährenden Darmstörung, die die Ärzte am Hofe nicht zu heilen vermochten. 1526 z.B., lag er wieder einmal siech darnieder. Ein Fachmann musste her, einer, von dem man sich Wunderdinge versprach. So einer wie Theophrastus Bombast von Hohenheim, besser bekannt unter dem Namen Paracelsus, der, von unbestrittener Kompetenz, sich zu der Zeit in Süddeutschland aufhielt und der es richten sollte. So habe er z.B. in Ingolstadt ein Mädchen geheilt, das gelähmt war. Nicht so viel Glück hatte hingegen Petrus von Burckhardis. Der war an seinem Asthma erstickt. In dem Fall war offensichtlich nichts mehr zu machen gewesen. Anders in Rottweil – da heilte er eine Äbtissin, die an Gürtelrose litt (derzeit kursierender Werbespruch: „Kann sehr belastend sein“).
Genug Empfehlungen also, nach dem Doktor zu schicken, der bald darauf wohl auch eintraf, um dem Markgrafen seine weithin gerühmte ärztliche Kunst angedeihen zu lassen. Und in der Tat war zu seiner Zeit Paracelsus das, was man eine Koryphäe nennt, ein Promidoktor, zu dem ‚man‘ ging.
Als einer der Ersten hatte er die Medizin auf eine neue Basis gestellt. Er studierte die Natur. „Umfasste sie nicht ein viel größeres Gebiet, als die Schulmedizin zuzugeben wagte?“ (H. Pächter „Paracelsus“) Der Mediziner schlug neue Behandlungswege ein, immer ausgehend von der zentralen Frage: was Krankheit eigentlich ist.
Wohl dem, der ihn in Zeiten der Not an seinem Krankenbett wusste. Wohl aber auch dem, der ihn nicht brauchte. Denn der Herr Doktor war ein rechter Zausel, der keiner Auseinandersetzung aus dem Weg ging, mit allen Streit anfing, dabei die Kollegen vor den Kopf stieß und allerlei mehr. Später, da war er schon weitergezogen nach Basel, berichtete sein Freund Oporinus in einem Brief, dass sich Paracelsus „dem Trunk und der Prasserei ergeben“ habe. „Die ganze Nacht…hat er sich nie ausgezogen, was ich seiner Trunkheit zuschrieb“.
„Dessen ungeachtet“ sei er, „wenn er am betrunkensten war“, zu seinem Schüler nach hause gekommen, um „mir etwas von seiner Philosophie zu diktieren“. In diesem Zusammenhang rühmte sein Schüler auch die Klarheit seiner Gedanken, „dass sie von einem nüchternen Menschen nicht hätten verbessert werden können“. Zudem hatte der Herr Doktor ein Schwert, das er bisweilen um Mitternacht wie ein Rasender aus der Scheide zog, es zu Boden schmiss, „so dass ich manchmal glaubte, er würde mir den Kopf abhauen“. So weit die Ausführungen des ‚Assistenten‘, das Verhalten seines Lehrmeisters betreffend, und man fragt sich unwillkürlich, warum heutzutage Assistenzärzte meine, sich über das Auftreten einzelner Chefärzte beklagen zu müssen.
Noch aber war es hier in Baden-Baden nicht so weit. Das war später, in Basel. Doch nun lag ein Fall vor, der die Behandlung des Besten bedurfte. Der Markgraf war krank, und zwar ernstlich. Und so schickte man nach dem Besten seiner Zunft, nach Parcelsus, der alsbald auch eintraf und mit der Fülle seiner Erfahrung konstatierte: dem Fürsten, der siech darniederlag, mache der Darm Probleme. Der Darm in seiner gereizten Form. Eine Darmreizung. So etwas würde zur Heilung Zeit brauchen. So verordnete er zunächst dem Markgrafen Ruhe und vor allem Geduld, beides solle die verabreichten Mittel ergänzen. Das allerdings würde sich hinziehen.
Ob der Markgraf jetzt auf einem guten Weg war? Möglich. Doch da hatte man nicht gerechnet mit den Medizinern vor Ort, die auf so einen wie diesen hergelaufenen Medicus gerade noch gewartet hatten, so einer, der sozusagen an ihnen vorbei den hohen Herren behandeln durfte. Die üblichen Eifersüchteleien also. Hinzu aber kam, dass sich der Hochgelahrte alsbald als das entpuppte, was er immer war: ein arroganter Rüpel, der sich der ortsansässigen Kollegen gegenüber so benahm, wie man es niedergelassenen Ärzten gegenüber besser nicht tut. Er wusste alles besser.
Die Schwachstelle der Behandlung war die Zeit, die sich Paracelsus ausbedungen hatte. Es solle gewartet werden, bis seine Mittel wirkten. Wunder dauern bisweilen etwas länger. Die Heilung brauche Zeit. Aber wie das bei Ärzten manchmal halt so ist: sie nehmen sich keine.
Offensichtlich hatte er aber nicht mit der Kamarilla gerechnet, die eifersüchtig geifernd um ihren Einfluss fürchtete und auch schon mal den avisierten Heilungsprozess hintertrieb. Er würde ihre Mittel als die seinen ausgeben, u.s.w. Sie geiferten weiter, intrigierten noch mehr.
Irgendwann wurde es wohl dem Markgrafen zu bunt, und so sah sich der Herbeigerufene ohne Entschädigung und Lohn entlassen, worauf der Herr Paracelsus verärgert das Weite suchte noch bevor die Krankheit den Patienten floh. Er verließ die Stadt, verbittert und sauer. Weiter zog es ihn nach Straßburg und von dort aus noch rief er unserem Fürsten hinterher: „Der Markgraf ist ein größerer Bescheißer als der Jud Messe von Thales“.
Besser zu zweit
 Dort, in der Sophienstraße, wo Baden-Baden ein bisschen an Münchens Maximilianstraße erinnert, und wo die Einkaufstüten von Hermes und Escada den Winterpelz auf Anmutigste schmücken, kann man in diesen Tagen ein schönes Beispiel der Entschleunigung sehen. Jetzt, da das jetzt fast schon vergangene Jahr sich seinem baldigen Ende zuschiebt, erleben wir dort einen älteren Herrn mit seinem wirklich sehr alten Hund beim täglichen Spaziergang auf dem breiten Spazierstreifen der Allee. An sich nichts Besonderes. Allerdings auf, wie behutsam, ja, man muss fast sagen, sorgsam und altersgerecht der eine mit dem anderen umgeht. So hinfällig jeder für sich selbst ist, so sehr nimmt er doch auf den anderen Rücksicht. Erst geht der ältere Herr ein paar Schritte, dann wartet er auf seinen Hund. Der wiederum kommt langsam heran, geht an seinem Herrn vorbei, blickt sich um, und wartet, bis, ja, man möchte fast sagen: Gleichstand erreicht ist. So schiebt sich das alte Duo allmählich vorwärts. Einer wartet, bis der andere nachkommt. Der Fortschritt ist halt manchmal eine Schnecke.
Dort, in der Sophienstraße, wo Baden-Baden ein bisschen an Münchens Maximilianstraße erinnert, und wo die Einkaufstüten von Hermes und Escada den Winterpelz auf Anmutigste schmücken, kann man in diesen Tagen ein schönes Beispiel der Entschleunigung sehen. Jetzt, da das jetzt fast schon vergangene Jahr sich seinem baldigen Ende zuschiebt, erleben wir dort einen älteren Herrn mit seinem wirklich sehr alten Hund beim täglichen Spaziergang auf dem breiten Spazierstreifen der Allee. An sich nichts Besonderes. Allerdings auf, wie behutsam, ja, man muss fast sagen, sorgsam und altersgerecht der eine mit dem anderen umgeht. So hinfällig jeder für sich selbst ist, so sehr nimmt er doch auf den anderen Rücksicht. Erst geht der ältere Herr ein paar Schritte, dann wartet er auf seinen Hund. Der wiederum kommt langsam heran, geht an seinem Herrn vorbei, blickt sich um, und wartet, bis, ja, man möchte fast sagen: Gleichstand erreicht ist. So schiebt sich das alte Duo allmählich vorwärts. Einer wartet, bis der andere nachkommt. Der Fortschritt ist halt manchmal eine Schnecke.
Unter all den guten Wünschen, mit denen wir den Jahreswechsel begleiten, sollte auch der sein, dass die beiden sich noch lange haben. Eine schöne Schicksalsgemeinschaft. Beide brauchen sich. So geht es voran. Zwar langsam, aber immerhin. Das wünschen wir für uns alle, ganz besonders aber für die beiden in der Sophienstraße.
Denen ganz besonders ein schönes und vor allem gemeinsames Fest. Zu Zweit fällt er halt leichter: der Schritt ins Neue Jahr!
Unser täglich Brot gib uns heute
…aber bitte nicht zwei Kilo auf einmal.
Das Leben einer Einzelhandelskauffrau ist keineswegs so einfach, wie man sich das gemeinhin so vorstellt. Ständig muss sie sich mit neuen Themen auseinandersetzen. Da taucht frische Ware auf. Neue Preise werden auf- , altes Wissen wird abgerufen. Und dann auch noch die Kundschaft mit all ihren Wünschen. Allein schon die Fleischtheke bietet eine Fülle von Herausforderungen, wenn es z.B. gilt, verschiedene Fleischsorten den korrespondierenden Tieren zuzuordnen. Allein schon so etwas erfordert eine ganze Menge an Knowhow. Glücklich, wer da noch das Berichtsheft aus der Zeit seiner Lehre in Reichweite hat. Etwas einfacher ist es, arbeitet man an der Fischtheke. Aber auch da wäre es gut, könnte man den Süßwasserfisch seiner Herkunft nach dem Viktoria- oder dem Titisee zuordnen. Weiter wäre gut zu wissen, dass der Rollmops von den Lofoten kommt und die Wiege der Schwarzwaldforelle in der Nähe von Freudenstadt steht.
Etwas leichter tut sich da die Verkäuferin an der Brottheke eines Supermarktes. Gut ausgebildet, wie sie ist, weiß sie z.B. dass das Brot, das sie verkauft, vom Bäcker kommt, was das Erfüllen des Kundenwunsches zwangsläufig enorm vereinfacht. Meist deutet der Kunden vor der Theke stehend ohnehin auf ein bestimmtes Brot im Regal und sagt: „Von dem da, bitte“. Ist der Service perfekt, wird die Fachfrau versuchen, den Wunsch des Kunden behutsam einzugrenzen, etwa dergestalt: in dem Brot da ist aber Kümmel drin.
So ähnlich war es mir erst kürzlich ergangen, als mich am Brotstand eine bestens ausgebildete Einzelhandelskauffrau auf diesen Unterschied hinwies. „Da ist aber Kümmel drin“, sagte sie mit leichtem Bedauern, denn das Brot war von gestern und hätte weggemusst. Gut, dass es diese Sorte dann aber auch ohne Kümmel gab, weshalb sie nach einem frischen Laib griff. Eigentlich hätte sie sich gewünscht, dass die Menge ungeteilt über die Ladentheke geht. So traf sie meine Bitte um die Zuteilung von 300 Gramm ziemlich unvermittelt. Mit verdunkeltem Blick wuchtete sie den Laib auf das Schnittbrett, waltete ihres Amtes, schnitt ab und legte das Stück auf die Waage. 500 Gramm. Beim Einpacken fragte sie noch schnell, ob es recht sei. Nein, sagte ich. Da ich kein altes Brot mag, sagte ich, ich hätte gern 300 Gramm. Zu fortgeschrittener Arbeitszeit auch noch ein renitenter Kunde – das hatte ihr gerade noch gefehlt. Zugeteilter Brotabschnitt also wieder zurück. Restlaib wieder her. Jetzt drehte sie den Spieß um. Sie wurde bockig.
Dann solle ich ihr doch jetzt bitte mal sagen, wie viel Brot ich eigentlich will. Ich sagte 300 Gramm. Auf dem Schnittbrett lagen zwei Kilo, zudem das Messer und die Hand, die es hielt. Sie schien offensichtlich nicht gewillt, ihre Kenntnisse der Mengenlehre als Teil ihrer Ausbildung heranzuziehen. Noch ruhte das Brotmesser in ihrer Hand. Ihr Blick war herausfordernd. Unter keinen Umständen schien sie gewillt, sich dem Wunsch des Kunden nach der erbetenen Schnittmenge zu stellen. Unter diesen Umständen schien ihr sogar geboten, Verantwortung abzugeben, das Bestimmen der Menge also auf den Kunden abzuwälzen. Sie rückte ihren enormen Laib in die Mitte und legte das Messer an. Wie viel, sagte sie, soll’s denn sein? Ich sagte 300 Gramm. Soweit ich durch das Schutzglas der Theke sehen konnte, zitterte ihre Messerhand jetzt leicht.
Der Kunde blieb jetzt nur noch die herausfordernde Möglichkeit, sich vor ihrem verdüsterten Auge zu blamieren. Jetzt also wäre es an mir, sich der kaum zu bewältigende Aufgabe der Mengenzuteilung zu stellen. 300 Gramm wollen schließlich mengengenau abgeschnitten sein. Dass sie ihre gesamte berufliche und private Existenz ursprünglich darauf gegründet hatte, dem Kunden die gewünschte Menge Brot zu verkaufen, blieb in diesem Zusammenhang unerwähnt.
Mittlerweile hatte sich vom Käse her ihr Kollege genähert, der, am Rande des Emmental friedlich agierend, mitbekommen hatte, dass sich nebenan wohl ein Konflikt abzeichnet, der – wie so viele weltweite Auseinandersetzungen – wohl in der Verteilung der Resource ‚Nahrung‘ seinen Ursprung nahm. Schnell aber ahnte er, wie komplex das Thema war. So schien es ihm das Klügste, sich lieber wieder dem traditionell abgepackten Backsteinkäs‘ zuzuwenden.
Noch aber thronte hinterm Tresen diese massive Brotmamsell, nicht willens, auch nur eine Schnitte nachzugeben. Das Blitzen der vor ihr senkrecht stehenden Klinge im Auge ließ ich mich letztlich darauf ein, die gewünschte Menge selbst zu bestimmen, was – da ich die Nerven verlor – in einem schmachvollen, mich rundum demütigenden Prozess endete. Millimeterweise verschob sie ihr Brotmesser auf dem Brotlaib, mich fixierend und abfragend: soll’s so viel sein, oder soviel, oder sogar soviel?
Fix und fertig wie ich jetzt noch beim Schreiben bin, gab ich ein erschöpftes ‚In Ordnung‘ von mir. Als die Waage ‚450 Gramm‘ anzeigte, war meine Niederlage schlechterdings nicht mehr zu leugnen, zumal mir dieser Brotleib die Übermenge vor allen Umstehenden auch noch laut und höhnisch ansagte.
Vor aller Augen gedemütigt, machte ich mich davon (verkrümelte mich also), fest entschlossen, als Speisebeilage in Zukunft mehr auf die Kartoffel zu setzen.