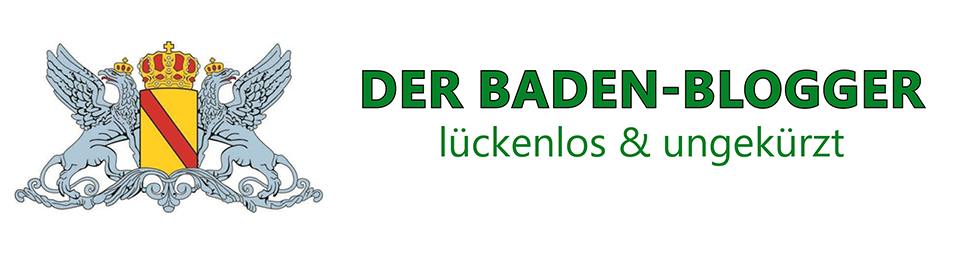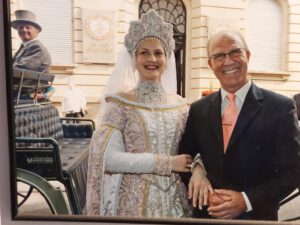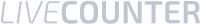Schließlich wird Russlands Zukunft derzeit vor allem rückwärts gedacht.
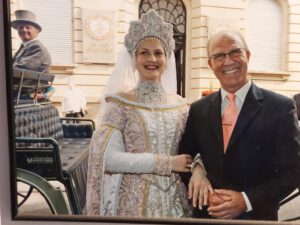
Hier der Besitzer der Eier mit seiner Frau. Sie ist nicht aus Marzipan. Und steht auch nicht auf einer Hochzeitstorte.
Und so verfiel er auf der Suche nach Symbolen auch auf die Fabergé Eier, die, nach den revolutionären Wirren in alle Winde zerstreut, endlich wieder heimgeholt werden sollten, ins heilige russische Reich. Fortan wurden die Neureichen von Putins Gnaden, die Oligarchen, angewiesen, in weltweiten Ostermärschen die Fabergé Eier einzusammeln und wieder in russische Hände zu legen.
Zwei, die dem Ruf unmittelbar Folge leisteten, waren denn auch der Oligarch Alexander Iwanow und sein Kompagnon Konstantin Goloschtschapow, auch „Putins Masseur“ genannt. Die beiden also ersonnen die Idee, 2009 in Baden-Baden, dem vermeintlichen Außenposten der ansonsten eher unsichtbaren russischen Seele, eine Dependance zu gründen, das‚ Fabergé Museum‘ in der Sophienstrasse, eine kleine Allee, die zur Hoch-Zeit der Russeneuphorie zahlreiche Edeladressen beheimatete, wie Bogner, Hermes u.v.a.
Das Haus, das das Museum beherbergt, ist, wie die Eintrittspreise von € 23, eher stattlich. Dafür steht an schönen Tagen vor dem Eingang allerdings auch ein saisonal bestückter Blumenkübel, der dem Besucher den Weg ins Innere weist. Anders als im aktuellen Flyer beschrieben, beschränken sich die Öffnungszeiten – sicherlich bedingt auch durch die derzeit deutlich reduzierte Russeneuphorie – auf die Kernzeiten Do-So. Das Personal besteht aus Damen russischer Herkunft im sogenannten besten Alter und auch darüber. Sie dienen, so der Prospekt, dem „Wahren, Schönen, Guten“. Sucht man mit ihnen das Gespräch, darf man darauf vertrauen, dass ihr Glaube an die vergangene Größe Russlands mindestens so große ist wie der Glaube an den deutschen Sozialstaat. Auf frühere Nachfragen hielten sie lange und tapfer daran fest, dass Russland und Deutschland eigentlich die geborenen Partner seien. Der Deutsche hätte den Ingenieursgeist und der Russe die Rohstoffe.
Im Moment aber bewachen sie bei abnehmendem öffentlichen Besucherinteresse ein Museum, dessen Inneres, nett formuliert, an ein wahrhaft großbürgerliches Wohnen im 19. Jahrhundert erinnert, mit allen Versatzstücken, die damals zum Darstellen gesättigten Daseins gehörten. Vor allem aber Salons en Masse, die nunmehr Unmengen Schaukästen beherbergen. Nicht so nett formuliert, ist es ein rechtes Durcheinander, das Wichtiges neben nicht so Wichtigem präsentiert.
 So rätselt der Fabergé Freund, was das „Gold der Welt“ mit „kostbaren goldenen Kleinoden…aus vor allem präkolumbischer, asiatischer, skytischer, persischer, keltischer, römischer Herkunft bis in unsere Zeit“ zu tun hat, mit den versprochenen Pretiosen zaristischer Herrschaft. An den Wänden eine reiche Bildgalerie aus tatsächlich eben dieser Epoche, allerdings wenig strukturiert und unklar kommentiert. Natürlich Bilder der Zarenfamilie, von denen bei ruhiger Betrachtung dem Interessierten vielleicht auch das Bild der Zarin ins Auge fällt. Sie muss eine sehr schöne Frau gewesen sein, doch fällt einem ihr Blick voll großer Traurigkeit auf.
So rätselt der Fabergé Freund, was das „Gold der Welt“ mit „kostbaren goldenen Kleinoden…aus vor allem präkolumbischer, asiatischer, skytischer, persischer, keltischer, römischer Herkunft bis in unsere Zeit“ zu tun hat, mit den versprochenen Pretiosen zaristischer Herrschaft. An den Wänden eine reiche Bildgalerie aus tatsächlich eben dieser Epoche, allerdings wenig strukturiert und unklar kommentiert. Natürlich Bilder der Zarenfamilie, von denen bei ruhiger Betrachtung dem Interessierten vielleicht auch das Bild der Zarin ins Auge fällt. Sie muss eine sehr schöne Frau gewesen sein, doch fällt einem ihr Blick voll großer Traurigkeit auf.
Ein Grund war sicher der damalige Zustand des Russischen Reiches, aber auch die unheilbare Krankheit des möglichen Thronfolgers. Angesichts dieser riesigen Probleme wird ein anderes Problem sicherlich nachrangig zu bewerten sein: es präsentieren sich in Schaukästen die Unmenge Zigarrettenetuis, von denen die Firma Fabergé eine größere Anzahl wohl auch an den Hof geliefert hatte. Es scheint, als sei der Zar ein großer Raucher gewesen.
Welches dieser Etuis vom Zar selbst benutzt worden war, bleibt unklar, wie so vieles in der Ausstellung. Zu selten ist klar erkennbar, was der Familie zugehörig und was nicht. Wenn die Aura eines Gegenstandes letztlich der Grund sein sollte, diese Sammlung zu besichtigen, so liegt hier der Grund nicht klar auf der Hand. Natürlich ahnt man, was für geniale Handwerker es waren, die im Auftrag der Familie Fabergé handwerkliche Meisterleistungen vollbrachten, aber eine klarere Trennung wird nicht deutlich.
Familie zugehörig und was nicht. Wenn die Aura eines Gegenstandes letztlich der Grund sein sollte, diese Sammlung zu besichtigen, so liegt hier der Grund nicht klar auf der Hand. Natürlich ahnt man, was für geniale Handwerker es waren, die im Auftrag der Familie Fabergé handwerkliche Meisterleistungen vollbrachten, aber eine klarere Trennung wird nicht deutlich.
Wer sich nach einem Gang durch die Ausstellung nun nach dem Eigner des Museum erkundigt, stößt auf blankes Unverständnis. Nein, der Herr Iwanow sei nicht da. Wann er denn wieder käme? Unklar, er sei nicht zu sprechen. Und die Fabergé Eier? Welche seien echt, welche nicht? Langsam wird es ihr unangenehm, und so beschließt man, das Nachfragen einzustellen. Tatsache scheint zu sein, dass in Baden-Baden wohl ursprünglich drei Eier ausgestellt waren, die man der Zarenfamilie zuordnen konnte. Diese aber hatten sich wundersamerweise irgendwie und irgendwann auf unklare Weise nach Russland abgesetzt, so wie der Herr Iwanow selbst, der irgendwann hier auch nicht mehr gesehen ward.
Was man hier in jedem Fall aber kaufen kann, sind billige Kopien der Pretiosen. Verglichen mit den ursprünglichen Kaufpreisen von z.B. € 12,5 Mio für das ‚Rothschild-Ei‘ – ursprünglich der Höhepunkt der Sammlung – sind sie hier für vergleichsweise günstige € 200 zu haben.
Russland im Ausverkauf.
 …im Fabergé Museum in Baden-Baden
…im Fabergé Museum in Baden-Baden