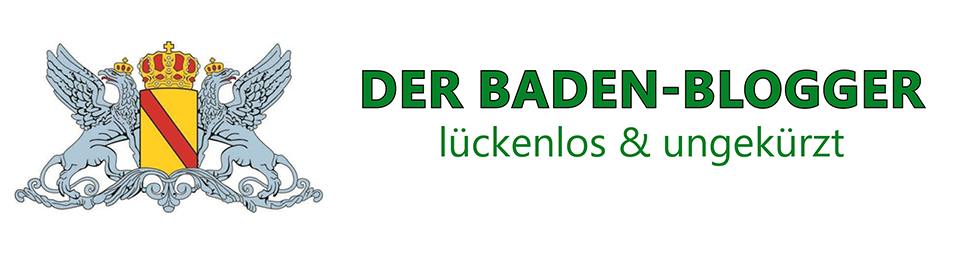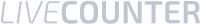Wieso unsere Gäste wieder einmal Iwan Turgenjew lesen sollten
Wieso unsere Gäste wieder einmal Iwan Turgenjew lesen sollten
Für die Russen ist die Lichtentaler Allee so etwas wie die Rennstrecke in die Vergangenheit. Täglich machen sich ganze Scharen russischer Besucher auf, um sich spazierend zurück zu träumen in eine bessere Welt, damals, als Russland noch groß und der Zar noch am Leben war. Es hat den Anschein, als liebten die Russen die Allee. Fast noch mehr, als es die dort watschelnden Enten tun.
Wer beim allfälligen Spaziergang jedoch den Blick schweifen lässt, dem wird das Denkmal von Iwan Turgenjew auffallen, das, oft mit Blumen dekoriert, ebenfalls von der glorreichen Zeit berichtet, als Baden-Baden noch die ‚Sommerhauptstadt Europas‘ genannt wurde und der Zarenhof mit Kind, Kegel, Bediensteten und Mätressen alljährlich hier Quartier nahm. Und mit im Gefolge die Creme de la Creme der russischen Dichter, die als Hofpoeten allerdings nicht so recht taugen wollten.
Den Mythos begründet, dass Baden-Baden eine beinahe russische Stadt sei, haben sie allemal. Wer sieht, wie andächtig russische Besuchergruppen Dichterhäusern Referenz erweisen, wie ihre blonden Töchter einen Augenblick lang das iPhone vergessen und die Väter kurz den Blick vom ‚Löwenbräu‘ nehmen, der ahnt, wieviel auch dem einfachen Russen seine Dichter bedeuten. Und doch wäre es der russischen Selbsterkenntnis durchaus zuträglich, nähme man sich Zeit für deren Lektüre. Was ein Stück weit auch mit der derzeitigen Lage zu tun hat.
Es soll hier keineswegs die derzeitige Malaise Russlands mit den durch Putin und den seinen hervorgerufenen Großreichträumen im Detail dargestellt werden. Die Lage scheint nur so zu sein: bedingt durch den Absturz des Ölpreises nebst Sanktionen des Westens gerät das schwere Reich zunehmend ins Wanken, ja, es wird schon spekuliert, ob Putin das Jahr 2016 noch in seinem Amt erleben wird. Der Grund: Russland hat es in all den Jahren großer Einnahmen versäumt, selbst im Ansatz eine eigene produktive Wirschaft aufzubauen. „Je hochwertiger die Technologie, umso schwerer können wir die Importprodukte ersetzen“, erklärt Vladimir Zujev, Professor am Institut für globale Ökonomie der Moskauer Higher School of Economics. Hinzu kommen die riesigen Schäden durch Alkohol am Arbeitsplatz. Kurz: die Lage ist düster. Neu ist sie nicht.
Machen wir jetzt einmal den Russen die Freunde…..