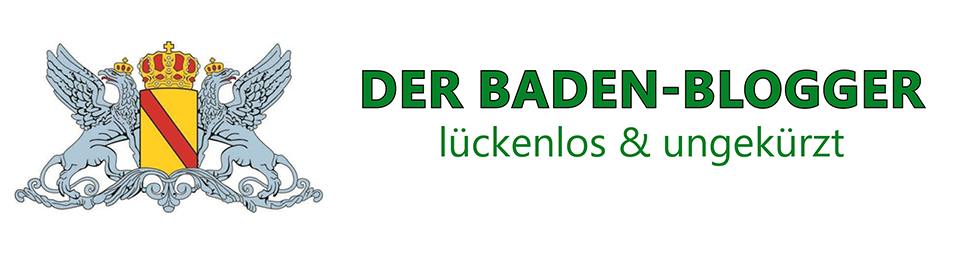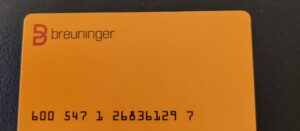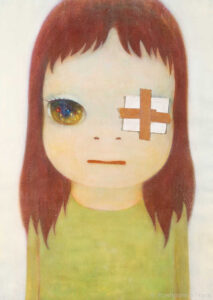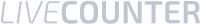Auf der Suche nach der dortigen Seele
Auf der Suche nach der dortigen Seele
Wenn unsereiner die kleine Stadt verlässt, die ja so schön ist, dass man ihren Namen zwei Mal nennen muss, dann sollte es sich bitte schön doch lohnen. Tübingen z.B. wäre schon mal so eine Reise wert. Tübingen! Stadt der Philosophen, der verblichenen Denker und eines grünen Oberbürgermeisters mit dem Namen Boris Palmer, der aber noch lebt. Ernst Bloch aber ist tot, Hans Mayer weilt schon lange nicht mehr unter uns, und Walter Jens ist nach langer Krankheit nun auch schon verstorben. Wollte man diese Geistesgrößen früher treffen, musste man nur in der Osiander’schen Buchhandlung in der Metzgergasse vorbeischauen. Da konnte man an je bestimmten Tagen dem Weltgeist beim Teetrinken zusehen.
Aber das ist ja nun schon ein Weilchen her. Nix mehr mit Weltgeist beim Tee. Dann also das Alternativprogramm. Ich beschließe, ein mir empfohlenes Restaurant in der Ammergasse aufzusuchen. Dort gibt’s zwar allenfalls Himbeergeist, dafür aber Maultaschen und Schwabenbräu, serviert von einer Bedienung, die wieder einmal bestätigt, dass Freundlichkeit in schwäbischen Wirtschaften allenfalls ein formlos erklärter Gewaltverzicht ist. Diese sicherlich nett gemeinten Grobheiten wurden aber mehr als wettgemacht durch den Unterhaltungswert zweier Zimmerleute, die sich am Nachbartisch über die Figur des Widerstandskämpfers Graf Stauffenberg in die Haare gerieten. Der eine sagte, für ihn sei Stauffenberg ein Held. Der andere bezeichnete ihn als Arschloch. Damit war der Begrifflichkeit genüge getan, und man konnte ans Streiten gehen.
Ich möchte hier nicht die Auseinandersetzung in allen Verästelungen wiedergeben. Nur soviel: nach heftigsten Wortwechseln mit angedrohten Schlägen kam es zu guter Letzt dann doch noch zu einer Versöhnung. Ob darüber die Figur Graf Stauffenbergs auf der Strecke geblieben war, hatte ich irgendwie nicht ganz mitbekommen, steht aber zu vermuten. Mittlerweile hatte sich zudem noch die Bedienung vor mir aufgebaut und bellte: „Zahle“, wobei ich nicht wusste, ob dies als Frage oder Befehl zu verstehen war.
Was mir aber noch deutlich in Erinnerung geblieben ist, war der Satz, den der eine Zimmermann dem anderen dann doch noch fröhlich versöhnt zugerufen hatte. „Woisch was: jetzt trinksch ä klöis Bier auf mei Rechnung“.
Dieser an sich schlichte Satz bedarf aus gegebenem Anlass – noch sind wir in der Denkerstadt Tübingen! – der hermeneutischen Deutung. „Woisch was“ (das weist auf den Hammer hin, der gleich kommt). „Jetzt trinksch…“ (ich trinke nicht mit) „ä klöis Bier“ (kein großes, sondern ein kleines Bier) „auf mei Rechnung“. Der Bestellende ist also zahlungswillig. Damit das alles klar ist.
Im Badischen hätte es geheißen: „Jetzt trinken wir ein Bier“. Dann wäre klar gewesen: zunächst einmal ist das ein ganz normaler Vorgang. Weiter: wir trinken zwei Gläser Bier und zwar große. Im übrigen trinke ich mit, und das ganze geht natürlich auf meine Rechnung.
Soweit, so badisch. Irgendwie muss man sie einfach lieben, unsere Schwaben…!