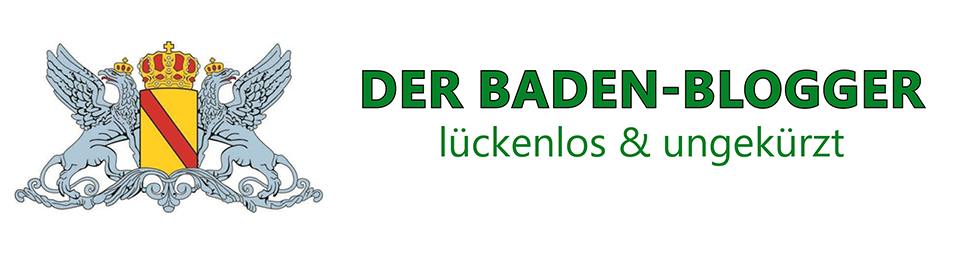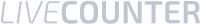Wie ich einmal nach Kehl kam
 Wer fliehen will, sollte wissen, womit und wohin. Ich stand am Bahnhof in Baden-Baden und wartete auf den Zug Richtung Süden, nach Freiburg. In einiger Entfernung sah ich eine Kollegin, die wie ich auf den Zug wartete, und in deren Gesellschaft ich keinesfalls die nächste Stunde verbringen wollte. Sie war ein hasenzähniges Wesen mit meist etwas zu langen Röcken. Sie gab sich leutselig, immer bestrebt, sich mit jedwelchen Kollegen auf eine vermeintliche Kumanei einzulassen. Man durfte ihr aber nicht trauen. Mit ziemlicher Sicherheit würde sie mich über die Dauer der gesamten Fahrstrecke mit mir noch nicht bekannten Interna aus dem Betrieb versorgen. Mir drohte eine Stunde Langeweile. Die von ihr verbreiteten Gerüchte würden mich, je nachdem was sie mir erzählte, ratlos oder wütend machen.
Wer fliehen will, sollte wissen, womit und wohin. Ich stand am Bahnhof in Baden-Baden und wartete auf den Zug Richtung Süden, nach Freiburg. In einiger Entfernung sah ich eine Kollegin, die wie ich auf den Zug wartete, und in deren Gesellschaft ich keinesfalls die nächste Stunde verbringen wollte. Sie war ein hasenzähniges Wesen mit meist etwas zu langen Röcken. Sie gab sich leutselig, immer bestrebt, sich mit jedwelchen Kollegen auf eine vermeintliche Kumanei einzulassen. Man durfte ihr aber nicht trauen. Mit ziemlicher Sicherheit würde sie mich über die Dauer der gesamten Fahrstrecke mit mir noch nicht bekannten Interna aus dem Betrieb versorgen. Mir drohte eine Stunde Langeweile. Die von ihr verbreiteten Gerüchte würden mich, je nachdem was sie mir erzählte, ratlos oder wütend machen.
Zum Glück rollte jetzt der Zug ein. Ich war fest entschlossen, mich durch möglichst schnelles Zusteigen ihrem Blick zu entziehen. Klassisches Fluchtverhalten
Nachdem die Wagentür sich hinter mir geschlossen hatte, entspannte ich mich. Fürs erste war ich gerettet. Der Zug war gut besetzt. Zunächst musste ich über zwei glatzköpfige Jugendliche steigen, die es sich, auf dem Boden sitzend, im Eingangsbereich bequem gemacht hatten. Immerhin fuhr der Zug gleich los, und bei den vielen Waggons, die zwischen meiner Kollegin und mir lagen, schien es eher unwahrscheinlich, dass sie sich zu mir durchkämpfen würde. Außerdem konnte sie mich nach Lage der Dinge ja nicht gesehen haben.
Nach längerem Suchen hatte ich einen freien Platz erspäht. Wieder stieg ich über Kahlköpfige junge Männer, was bei mir zu dem Zeitpunkt aber noch keinen Verdacht aufkommen ließ. Mode ist ja stets zeitgebunden. Jede Zeit hat ihren Stil, ihre Frisuren. Was man gestern trug, kann heute schon veraltet sein. Und umgekehrt.
Man sprach Französisch, was in einer Grenzregion ja auch nichts Besonderes ist. Allerdings sahen mich die Mitfahrenden an, als käme ich von einem anderen Stern. Lag es an meiner Frisur? Ich war zwischenzeitlich doch etwas unsicher geworden. Das änderte sich aber, als der Schaffner in einer mir zunächst nicht vertrauten Uniform das Abteil betrat. Er kontrollierte meine Karte und fragte mich beiläufig, ob ich etwa zum französischen Militär wolle? Zur Grand Armee? Der Zug, sagte er, sei ein Militärtransport. Ich sei in den falschen Zug gestiegen. Der hier sei auf dem Weg nach Paris, nicht nach Freiburg. Er würde mir raten – sagte er lächelnd – an der nächsten Bahnstation auszusteigen. Noch sei es ja nicht zu spät. Noch seien wir in Deutschland.
Vor vielen Jahren hatte mir ein Lokaljournalist, den ich fragte, wo er arbeite, zugeraunt: „Wer Vater und Mutter nicht ehrt muss nach Kehl“. Und in der Tat: wer sich wie ich in Kehl auf einer schmutzigen Bank vor dem Bahnhof sitzend wiederfindet, ahnt, was er damit gemeint hatte. Normalerweise rollt dort eine schier nicht endenwollende Autoschlange vorbei: die vielen Pendler, die, von der Arbeit in Deutschland kommend, nach Straßburg zurückkehren. Dreht man sich mich um, fällt der Blick auf einen herabgewirtschafteten Bau, gleich neben dem Bahnhof. Es ist das „Hotel Astoria“, dessen schmuddeliges Äußeres die wenigen dort verkehrenden Gäste offensichtlich nicht zu stören scheint.
Noch beim Betrachten des „Astoria“ fiel mir auf, dass sich zwischenzeitlich ein Zeitgenosse genähert hatte. Er trug einen Mundschutz der etwas aufwändigeren Sorte, also nichts Selbstgenähtes. Sein Modell hatte eine spitz zulaufende Schnauze mit einer vorne abgeflachten Spitze. Soweit ich sah war in diese Spitze eingesetzt ein kleiner Filter mit zwei Luftlöchern, was dem Träger das Aussehen eines freundlich drein-blickenden Ferkels mit Schnute gab. Der Mann sprach mich an, war aber durch den Rüssel seiner Anti-Corona-Maßnahme schlecht zu verstehen. Das wenige, das ich mitbekam, lief darauf hinaus, dass er einen Mangel an Respekt seitens der Deutschen beklagte. Schließlich sei er ein Zigeuner. Ich darf das sagen, denn er sagte von sich selbst, er sei ein ‚Zigeuner‘. Zudem sei er ein ‚Fighter‘, eine Selbsteinschätzung, die er durch einige kurze, ruckhafte Handbewegungen unterstrich. Jeden, der ihn tot mache, mache auch er tot, sagte er mir. Ich müsse vor ihm aber keine Angst haben.
Im vorliegenden Fall wäre es vielleicht angebracht gewesen, ihm das Büro der Fremdenlegion in Straßburg zu empfehlen. Ich war dort schon einmal vorbeigekommen. Nicht ganz weit von der Grenze gelegen, war es zumindest in meiner Erinnerung, in einem heruntergekommenen Backsteingebäude untergebracht, in der Rue d’Ostende, wo es mit seinem Stacheldraht und dem versifften Vorgärtchen für den ganzen Jammer dieses Berufsstandes stand. Während ich noch überlegte, wie ich ihm den Weg dorthin beschreiben sollte, gab er plötzlich Entwarnung: „Du und ich aber gut“, sagte er, was offensichtlich bedeuten sollte, dass wir beide letztlich doch herzensgute Menschen seien. Soweit ich das für mich beurteilen kann, stimmte ich ihm mit leichten Einschränkungen zu, worauf er sich plötzlich umdrehte und in der traurigen Tiefe der Kehler Bahnhofshalle verschwand. Das Letzte, das ich von ihm sah, waren die beiden blütenweißen Schnüre der Maske an seinem dunklen Hinterkopf.
Als ich dann endlich nach zweieinhalb Stunden Verspätung in Freiburg ankam, hielt ich ängstlich Ausschau nach meiner Kollegin. Von der war aber nichts mehr zu sehen.